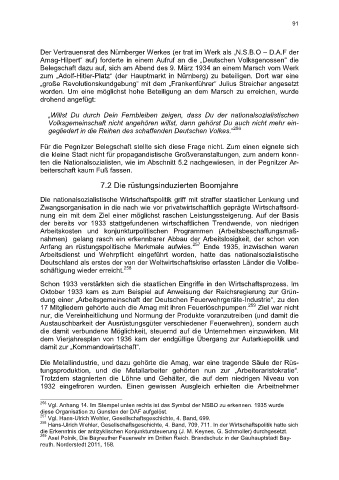Page 99 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 99
91
Der Vertrauensrat des Nürnberger Werkes (er trat im Werk als „N.S.B.O – D.A.F der
Amag-Hilpert“ auf) forderte in einem Aufruf an die „Deutschen Volksgenossen“ die
Belegschaft dazu auf, sich am Abend des 9. März 1934 an einem Marsch vom Werk
zum „Adolf-Hitler-Platz“ (der Hauptmarkt in Nürnberg) zu beteiligen. Dort war eine
„große Revolutionskundgebung“ mit dem „Frankenführer“ Julius Streicher angesetzt
worden. Um eine möglichst hohe Beteiligung an dem Marsch zu erreichen, wurde
drohend angefügt:
„Willst Du durch Dein Fernbleiben zeigen, dass Du der nationalsozialistischen
Volksgemeinschaft nicht angehören willst, dann gehörst Du auch nicht mehr ein-
gegliedert in die Reihen des schaffenden Deutschen Volkes.“ 256
Für die Pegnitzer Belegschaft stellte sich diese Frage nicht. Zum einen eignete sich
die kleine Stadt nicht für propagandistische Großveranstaltungen, zum andern konn-
ten die Nationalsozialisten, wie im Abschnitt 5.2 nachgewiesen, in der Pegnitzer Ar-
beiterschaft kaum Fuß fassen.
7.2 Die rüstungsinduzierten Boomjahre
Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik griff mit straffer staatlicher Lenkung und
Zwangsorganisation in die nach wie vor privatwirtschaftlich geprägte Wirtschaftsord-
nung ein mit dem Ziel einer möglichst raschen Leistungssteigerung. Auf der Basis
der bereits vor 1933 stattgefundenen wirtschaftlichen Trendwende, von niedrigen
Arbeitskosten und konjunkturpolitischen Programmen (Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen) gelang rasch ein erkennbarer Abbau der Arbeitslosigkeit, der schon von
Anfang an rüstungspolitische Merkmale aufwies. 257 Ende 1935, inzwischen waren
Arbeitsdienst und Wehrpflicht eingeführt worden, hatte das nationalsozialistische
Deutschland als erstes der von der Weltwirtschaftskrise erfassten Länder die Vollbe-
schäftigung wieder erreicht. 258
Schon 1933 verstärkten sich die staatlichen Eingriffe in den Wirtschaftsprozess. Im
Oktober 1933 kam es zum Beispiel auf Anweisung der Reichsregierung zur Grün-
dung einer „Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Feuerwehrgeräte-Industrie“, zu den
17 Mitgliedern gehörte auch die Amag mit ihren Feuerlöschpumpen. 259 Ziel war nicht
nur, die Vereinheitlichung und Normung der Produkte voranzutreiben (und damit die
Austauschbarkeit der Ausrüstungsgüter verschiedener Feuerwehren), sondern auch
die damit verbundene Möglichkeit, steuernd auf die Unternehmen einzuwirken. Mit
dem Vierjahresplan von 1936 kam der endgültige Übergang zur Autarkiepolitik und
damit zur „Kommandowirtschaft“.
Die Metallindustrie, und dazu gehörte die Amag, war eine tragende Säule der Rüs-
tungsproduktion, und die Metallarbeiter gehörten nun zur „Arbeiteraristokratie“.
Trotzdem stagnierten die Löhne und Gehälter, die auf dem niedrigen Niveau von
1932 eingefroren wurden. Einen gewissen Ausgleich erhielten die Arbeitnehmer
256
Vgl. Anhang 14. Im Stempel unten rechts ist das Symbol der NSBO zu erkennen. 1935 wurde
diese Organisation zu Gunsten der DAF aufgelöst.
257
Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 4. Band, 699.
258
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 4. Band, 709, 711. In der Wirtschaftspolitik hatte sich
die Erkenntnis der antizyklischen Konjunktursteuerung (J. M. Keynes, G. Schmoller) durchgesetzt.
259
Axel Polnik, Die Bayreuther Feuerwehr im Dritten Reich. Brandschutz in der Gauhauptstadt Bay-
reuth. Norderstedt 2011, 158.