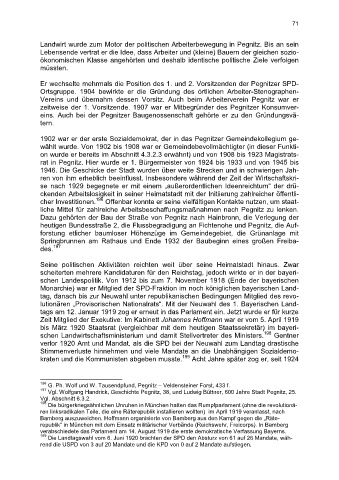Page 79 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 79
71
Landwirt wurde zum Motor der politischen Arbeiterbewegung in Pegnitz. Bis an sein
Lebensende vertrat er die Idee, dass Arbeiter und (kleine) Bauern der gleichen sozio-
ökonomischen Klasse angehörten und deshalb identische politische Ziele verfolgen
müssten.
Er wechselte mehrmals die Position des 1. und 2. Vorsitzenden der Pegnitzer SPD-
Ortsgruppe. 1904 bewirkte er die Gründung des örtlichen Arbeiter-Stenographen-
Vereins und übernahm dessen Vorsitz. Auch beim Arbeiterverein Pegnitz war er
zeitweise der 1. Vorsitzende. 1907 war er Mitbegründer des Pegnitzer Konsumver-
eins. Auch bei der Pegnitzer Baugenossenschaft gehörte er zu den Gründungsvä-
tern.
1902 war er der erste Sozialdemokrat, der in das Pegnitzer Gemeindekollegium ge-
wählt wurde. Von 1902 bis 1908 war er Gemeindebevollmächtigter (in dieser Funkti-
on wurde er bereits im Abschnitt 4.3.2.3 erwähnt) und von 1908 bis 1923 Magistrats-
rat in Pegnitz. Hier wurde er 1. Bürgermeister von 1924 bis 1933 und von 1945 bis
1946. Die Geschicke der Stadt wurden über weite Strecken und in schwierigen Jah-
ren von ihm erheblich beeinflusst. Insbesondere während der Zeit der Wirtschaftskri-
se nach 1929 begegnete er mit einem „außerordentlichen Ideenreichtum“ der drü-
ckenden Arbeitslosigkeit in seiner Heimatstadt mit der Initiierung zahlreicher öffentli-
cher Investitionen. 196 Offenbar konnte er seine vielfältigen Kontakte nutzen, um staat-
liche Mittel für zahlreiche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach Pegnitz zu lenken.
Dazu gehörten der Bau der Straße von Pegnitz nach Hainbronn, die Verlegung der
heutigen Bundesstraße 2, die Flussbegradigung an Fichtenohe und Pegnitz, die Auf-
forstung etlicher baumloser Höhenzüge im Gemeindegebiet, die Grünanlage mit
Springbrunnen am Rathaus und Ende 1932 der Baubeginn eines großen Freiba-
des. 197
Seine politischen Aktivitäten reichten weit über seine Heimatstadt hinaus. Zwar
scheiterten mehrere Kandidaturen für den Reichstag, jedoch wirkte er in der bayeri-
schen Landespolitik. Von 1912 bis zum 7. November 1918 (Ende der bayerischen
Monarchie) war er Mitglied der SPD-Fraktion im noch königlichen bayerischen Land-
tag, danach bis zur Neuwahl unter republikanischen Bedingungen Mitglied des revo-
lutionären „Provisorischen Nationalrats“. Mit der Neuwahl des 1. Bayerischen Land-
tags am 12. Januar 1919 zog er erneut in das Parlament ein. Jetzt wurde er für kurze
Zeit Mitglied der Exekutive: Im Kabinett Johannes Hoffmann war er vom 5. April 1919
bis März 1920 Staatsrat (vergleichbar mit dem heutigen Staatssekretär) im bayeri-
schen Landwirtschaftsministerium und damit Stellvertreter des Ministers. 198 Gentner
verlor 1920 Amt und Mandat, als die SPD bei der Neuwahl zum Landtag drastische
Stimmenverluste hinnehmen und viele Mandate an die Unabhängigen Sozialdemo-
kraten und die Kommunisten abgeben musste. 199 Acht Jahre später zog er, seit 1924
196
G. Ph. Wolf und W. Tausendpfund, Pegnitz – Veldensteiner Forst, 433 f.
197
Vgl. Wolfgang Handrick, Geschichte Pegnitz, 38, und Ludwig Büttner, 600 Jahre Stadt Pegnitz, 25.
Vgl. Abschnitt 6.3.2.
198
Die bürgerkriegsähnlichen Unruhen in München hatten das Rumpfparlament (ohne die revolutionä-
ren linksradikalen Teile, die eine Räterepublik installieren wollten) im April 1919 veranlasst, nach
Bamberg auszuweichen. Hoffmann organisierte von Bamberg aus den Kampf gegen die „Räte-
republik“ in München mit dem Einsatz militärischer Verbände (Reichswehr, Freicorps). In Bamberg
verabschiedete das Parlament am 14. August 1919 die erste demokratische Verfassung Bayerns.
199
Die Landtagswahl vom 6. Juni 1920 brachten der SPD den Absturz von 61 auf 26 Mandate, wäh-
rend die USPD von 3 auf 20 Mandate und die KPD von 0 auf 2 Mandate aufstiegen.