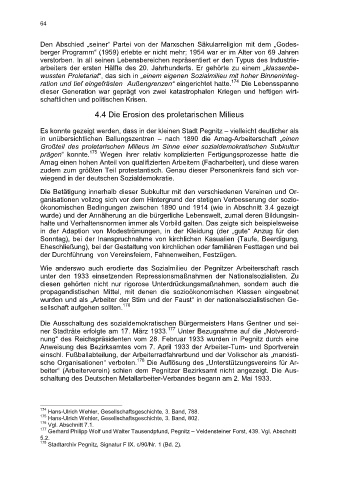Page 72 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 72
64
Den Abschied „seiner“ Partei von der Marxschen Säkularreligion mit dem „Godes-
berger Programm“ (1959) erlebte er nicht mehr; 1954 war er im Alter von 69 Jahren
verstorben. In all seinen Lebensbereichen repräsentiert er den Typus des Industrie-
arbeiters der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er gehörte zu einem „klassenbe-
wussten Proletariat“, das sich in „einem eigenen Sozialmilieu mit hoher Binneninteg-
ration und tief eingefrästen Außengrenzen“ eingerichtet hatte. 174 Die Lebensspanne
dieser Generation war geprägt von zwei katastrophalen Kriegen und heftigen wirt-
schaftlichen und politischen Krisen.
4.4 Die Erosion des proletarischen Milieus
Es konnte gezeigt werden, dass in der kleinen Stadt Pegnitz – vielleicht deutlicher als
in unübersichtlichen Ballungszentren – nach 1890 die Amag-Arbeiterschaft „einen
Großteil des proletarischen Milieus im Sinne einer sozialdemokratischen Subkultur
prägen“ konnte. 175 Wegen ihrer relativ komplizierten Fertigungsprozesse hatte die
Amag einen hohen Anteil von qualifizierten Arbeitern (Facharbeiter), und diese waren
zudem zum größten Teil protestantisch. Genau dieser Personenkreis fand sich vor-
wiegend in der deutschen Sozialdemokratie.
Die Betätigung innerhalb dieser Subkultur mit den verschiedenen Vereinen und Or-
ganisationen vollzog sich vor dem Hintergrund der stetigen Verbesserung der sozio-
ökonomischen Bedingungen zwischen 1890 und 1914 (wie in Abschnitt 3.4 gezeigt
wurde) und der Annäherung an die bürgerliche Lebenswelt, zumal deren Bildungsin-
halte und Verhaltensnormen immer als Vorbild galten. Das zeigte sich beispielsweise
in der Adaption von Modeströmungen, in der Kleidung (der „gute“ Anzug für den
Sonntag), bei der Inanspruchnahme von kirchlichen Kasualien (Taufe, Beerdigung,
Eheschließung), bei der Gestaltung von kirchlichen oder familiären Festtagen und bei
der Durchführung von Vereinsfeiern, Fahnenweihen, Festzügen.
Wie anderswo auch erodierte das Sozialmilieu der Pegnitzer Arbeiterschaft rasch
unter den 1933 einsetzenden Repressionsmaßnahmen der Nationalsozialisten. Zu
diesen gehörten nicht nur rigorose Unterdrückungsmaßnahmen, sondern auch die
propagandistischen Mittel, mit denen die sozioökonomischen Klassen eingeebnet
wurden und als „Arbeiter der Stirn und der Faust“ in der nationalsozialistischen Ge-
sellschaft aufgehen sollten. 176
Die Ausschaltung des sozialdemokratischen Bürgermeisters Hans Gentner und sei-
ner Stadträte erfolgte am 17. März 1933. 177 Unter Bezugnahme auf die „Notverord-
nung“ des Reichspräsidenten vom 28. Februar 1933 wurden in Pegnitz durch eine
Anweisung des Bezirksamtes vom 7. April 1933 der Arbeiter-Turn- und Sportverein
einschl. Fußballabteilung, der Arbeiterradfahrerbund und der Volkschor als „marxisti-
sche Organisationen“ verboten. 178 Die Auflösung des „Unterstützungsvereins für Ar-
beiter“ (Arbeiterverein) schien dem Pegnitzer Bezirksamt nicht angezeigt. Die Aus-
schaltung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes begann am 2. Mai 1933.
174
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, 788.
175
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, 802.
176
Vgl. Abschnitt 7.1.
177
Gerhard Philipp Wolf und Walter Tausendpfund, Pegnitz – Veldensteiner Forst, 439. Vgl. Abschnitt
5.2.
178
Stadtarchiv Pegnitz, Signatur F IX. c/90/Nr. 1 (Bd. 2).