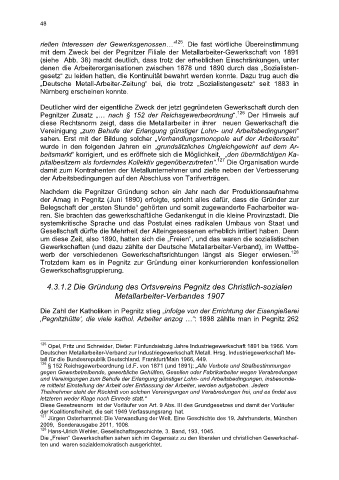Page 56 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 56
48
riellen Interessen der Gewerksgenossen…“ 125 . Die fast wörtliche Übereinstimmung
mit dem Zweck bei der Pegnitzer Filiale der Metallarbeiter-Gewerkschaft von 1891
(siehe Abb. 38) macht deutlich, dass trotz der erheblichen Einschränkungen, unter
denen die Arbeiterorganisationen zwischen 1878 und 1890 durch das „Sozialisten-
gesetz“ zu leiden hatten, die Kontinuität bewahrt werden konnte. Dazu trug auch die
„Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung“ bei, die trotz „Sozialistengesetz“ seit 1883 in
Nürnberg erscheinen konnte.
Deutlicher wird der eigentliche Zweck der jetzt gegründeten Gewerkschaft durch den
Pegnitzer Zusatz „… nach § 152 der Reichsgewerbeordnung“. 126 Der Hinweis auf
diese Rechtsnorm zeigt, dass die Metallarbeiter in ihrer neuen Gewerkschaft die
Vereinigung „zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen“
sahen. Erst mit der Bildung solcher „Verhandlungsmonopole auf der Arbeiterseite“
wurde in den folgenden Jahren ein „grundsätzliches Ungleichgewicht auf dem Ar-
beitsmarkt“ korrigiert, und es eröffnete sich die Möglichkeit, „den übermächtigen Ka-
pitalbesitzern als forderndes Kollektiv gegenüberzutreten“. 127 Die Organisation wurde
damit zum Kontrahenten der Metallunternehmer und zielte neben der Verbesserung
der Arbeitsbedingungen auf den Abschluss von Tarifverträgen.
Nachdem die Pegnitzer Gründung schon ein Jahr nach der Produktionsaufnahme
der Amag in Pegnitz (Juni 1890) erfolgte, spricht alles dafür, dass die Gründer zur
Belegschaft der „ersten Stunde“ gehörten und somit zugewanderte Facharbeiter wa-
ren. Sie brachten das gewerkschaftliche Gedankengut in die kleine Provinzstadt. Die
systemkritische Sprache und das Postulat eines radikalen Umbaus von Staat und
Gesellschaft dürfte die Mehrheit der Alteingesessenen erheblich irritiert haben. Denn
um diese Zeit, also 1890, hatten sich die „Freien“, und das waren die sozialistischen
Gewerkschaften (und dazu zählte der Deutsche Metallarbeiter-Verband), im Wettbe-
werb der verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen längst als Sieger erwiesen. 128
Trotzdem kam es in Pegnitz zur Gründung einer konkurrierenden konfessionellen
Gewerkschaftsgruppierung.
4.3.1.2 Die Gründung des Ortsvereins Pegnitz des Christlich-sozialen
Metallarbeiter-Verbandes 1907
Die Zahl der Katholiken in Pegnitz stieg „infolge von der Errichtung der Eisengießerei
‚Pegnitzhütte‘, die viele kathol. Arbeiter anzog …“: 1898 zählte man in Pegnitz 262
125
Opel, Fritz und Schneider, Dieter: Fünfundsiebzig Jahre Industriegewerkschaft 1891 bis 1966. Vom
Deutschen Metallarbeiter-Verband zur Industriegewerkschaft Metall. Hrsg. Industriegewerkschaft Me-
tall für die Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/Main 1966, 449.
126
§ 152 Reichsgewerbeordnung i.d.F. von 1871 (und 1891): „Alle Verbote und Strafbestimmungen
gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehülfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen
und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesonde-
re mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter, werden aufgehoben. Jedem
Theilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinigungen und Verabredungen frei, und es findet aus
letzteren weder Klage noch Einrede statt.“
Diese Gesetzesnorm ist der Vorläufer von Art. 9 Abs. III des Grundgesetzes und damit der Vorläufer
der Koalitionsfreiheit, die seit 1949 Verfassungsrang hat.
127
Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München
2009, Sonderausgabe 2011, 1008.
128
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, 193, 1045.
Die „Freien“ Gewerkschaften sahen sich im Gegensatz zu den liberalen und christlichen Gewerkschaf-
ten und waren sozialdemokratisch ausgerichtet.