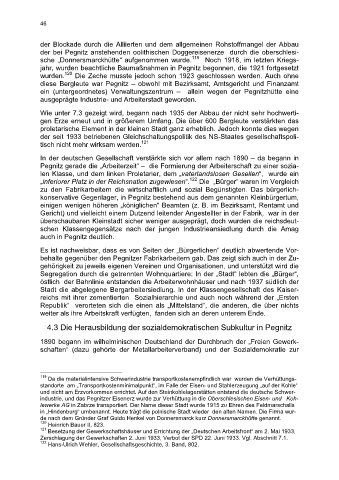Page 54 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 54
46
der Blockade durch die Alliierten und dem allgemeinen Rohstoffmangel der Abbau
der bei Pegnitz anstehenden oolithischen Doggereisenerze durch die oberschlesi-
sche „Donnersmarckhütte“ aufgenommen wurde. 119 Noch 1918, im letzten Kriegs-
jahr, wurden beachtliche Baumaßnahmen in Pegnitz begonnen, die 1921 fortgesetzt
wurden. 120 Die Zeche musste jedoch schon 1923 geschlossen werden. Auch ohne
diese Bergleute war Pegnitz – obwohl mit Bezirksamt, Amtsgericht und Finanzamt
ein (untergeordnetes) Verwaltungszentrum – allein wegen der Pegnitzhütte eine
ausgeprägte Industrie- und Arbeiterstadt geworden.
Wie unter 7.3 gezeigt wird, begann nach 1935 der Abbau der nicht sehr hochwerti-
gen Erze erneut und in größerem Umfang. Die über 600 Bergleute verstärkten das
proletarische Element in der kleinen Stadt ganz erheblich. Jedoch konnte dies wegen
der seit 1933 betriebenen Gleichschaltungspolitik des NS-Staates gesellschaftspoli-
tisch nicht mehr wirksam werden. 121
In der deutschen Gesellschaft verstärkte sich vor allem nach 1890 – da begann in
Pegnitz gerade die „Arbeiterzeit“ – die Formierung der Arbeiterschaft zu einer sozia-
len Klasse, und dem linken Proletarier, dem „vaterlandslosen Gesellen“, wurde ein
„inferiorer Platz in der Reichsnation zugewiesen“. 122 Die „Bürger“ waren im Vergleich
zu den Fabrikarbeitern die wirtschaftlich und sozial Begünstigten. Das bürgerlich-
konservative Gegenlager, in Pegnitz bestehend aus dem genannten Kleinbürgertum,
einigen wenigen höheren „königlichen“ Beamten (z. B. im Bezirksamt, Rentamt und
Gericht) und vielleicht einem Dutzend leitender Angestellter in der Fabrik, war in der
überschaubaren Kleinstadt sicher weniger ausgeprägt, doch wurden die reichsdeut-
schen Klassengegensätze nach der jungen Industrieansiedlung durch die Amag
auch in Pegnitz deutlich.
Es ist nachweisbar, dass es von Seiten der „Bürgerlichen“ deutlich abwertende Vor-
behalte gegenüber den Pegnitzer Fabrikarbeitern gab. Das zeigt sich auch in der Zu-
gehörigkeit zu jeweils eigenen Vereinen und Organisationen, und unterstützt wird die
Segregation durch die getrennten Wohnquartiere: In der „Stadt“ lebten die „Bürger“,
östlich der Bahnlinie entstanden die Arbeiterwohnhäuser und nach 1937 südlich der
Stadt die abgelegene Bergarbeitersiedlung. In der Klassengesellschaft des Kaiser-
reichs mit ihrer zementierten Sozialhierarchie und auch noch während der „Ersten
Republik“ verorteten sich die einen als „Mittelstand“, die anderen, die über nichts
weiter als ihre Arbeitskraft verfügten, fanden sich an deren unterem Ende.
4.3 Die Herausbildung der sozialdemokratischen Subkultur in Pegnitz
1890 begann im wilhelminischen Deutschland der Durchbruch der „Freien Gewerk-
schaften“ (dazu gehörte der Metallarbeiterverband) und der Sozialdemokratie zur
119
Da die materialintensive Schwerindustrie transportkostenempfindlich war wurden die Verhüttungs-
standorte am „Transportkostenminimalpunkt“, im Falle der Eisen- und Stahlerzeugung „auf der Kohle“
und nicht am Erzvorkommen errichtet. Auf den Steinkohlelagerstätten entstand die deutsche Schwer-
industrie, und das Pegnitzer Eisenerz wurde zur Verhüttung in die Oberschlesischen Eisen- und Koh-
lewerke AG in Zabrze transportiert. Der Name dieser Stadt wurde 1915 zu Ehren des Feldmarschalls
in „Hindenburg“ umbenannt. Heute trägt die polnische Stadt wieder den alten Namen. Die Firma wur-
de nach dem Gründer Graf Guido Henkel von Donnersmarck kurz Donnersmarckhütte genannt.
120
Heinrich Bauer II, 823.
121
Besetzung der Gewerkschaftshäuser und Errichtung der „Deutschen Arbeitsfront“ am 2. Mai 1933,
Zerschlagung der Gewerkschaften 2. Juni 1933, Verbot der SPD 22. Juni 1933. Vgl. Abschnitt 7.1.
122
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, 802.