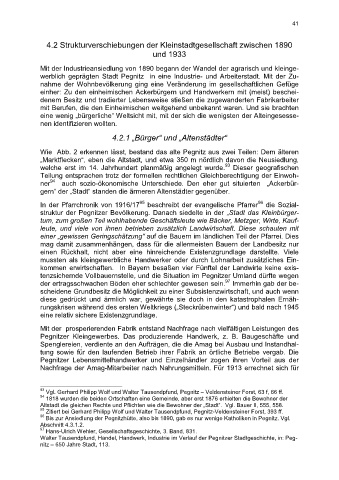Page 49 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 49
41
4.2 Strukturverschiebungen der Kleinstadtgesellschaft zwischen 1890
und 1933
Mit der Industrieansiedlung von 1890 begann der Wandel der agrarisch und kleinge-
werblich geprägten Stadt Pegnitz in eine Industrie- und Arbeiterstadt. Mit der Zu-
nahme der Wohnbevölkerung ging eine Veränderung im gesellschaftlichen Gefüge
einher: Zu den einheimischen Ackerbürgern und Handwerkern mit (meist) beschei-
denem Besitz und tradierter Lebensweise stießen die zugewanderten Fabrikarbeiter
mit Berufen, die den Einheimischen weitgehend unbekannt waren. Und sie brachten
eine wenig „bürgerliche“ Weltsicht mit, mit der sich die wenigsten der Alteingesesse-
nen identifizieren wollten.
4.2.1 „Bürger“ und „Altenstädter“
Wie Abb. 2 erkennen lässt, bestand das alte Pegnitz aus zwei Teilen: Dem älteren
„Marktflecken“, eben die Altstadt, und etwa 350 m nördlich davon die Neusiedlung,
93
welche erst im 14. Jahrhundert planmäßig angelegt wurde. Dieser geografischen
Teilung entsprachen trotz der formellen rechtlichen Gleichberechtigung der Einwoh-
94
ner auch sozio-ökonomische Unterschiede. Den eher gut situierten „Ackerbür-
gern“ der „Stadt“ standen die ärmeren Altenstädter gegenüber.
96
95
In der Pfarrchronik von 1916/17 beschreibt der evangelische Pfarrer die Sozial-
struktur der Pegnitzer Bevölkerung. Danach siedelte in der „Stadt das Kleinbürger-
tum, zum großen Teil wohlhabende Geschäftsleute wie Bäcker, Metzger, Wirte, Kauf-
leute, und viele von ihnen betrieben zusätzlich Landwirtschaft. Diese schauten mit
einer „gewissen Geringschätzung“ auf die Bauern im ländlichen Teil der Pfarrei. Dies
mag damit zusammenhängen, dass für die allermeisten Bauern der Landbesitz nur
einen Rückhalt, nicht aber eine hinreichende Existenzgrundlage darstellte. Viele
mussten als kleingewerbliche Handwerker oder durch Lohnarbeit zusätzliches Ein-
kommen erwirtschaften. In Bayern besaßen vier Fünftel der Landwirte keine exis-
tenzsichernde Vollbauernstelle, und die Situation im Pegnitzer Umland dürfte wegen
97
der ertragsschwachen Böden eher schlechter gewesen sein. Immerhin gab der be-
scheidene Grundbesitz die Möglichkeit zu einer Subsistenzwirtschaft, und auch wenn
diese gedrückt und ärmlich war, gewährte sie doch in den katastrophalen Ernäh-
rungskrisen während des ersten Weltkriegs („Steckrübenwinter“) und bald nach 1945
eine relativ sichere Existenzgrundlage.
Mit der prosperierenden Fabrik entstand Nachfrage nach vielfältigen Leistungen des
Pegnitzer Kleingewerbes. Das produzierende Handwerk, z. B. Baugeschäfte und
Spenglereien, verdiente an den Aufträgen, die die Amag bei Ausbau und Instandhal-
tung sowie für den laufenden Betrieb ihrer Fabrik an örtliche Betriebe vergab. Die
Pegnitzer Lebensmittelhandwerker und Einzelhändler zogen ihren Vorteil aus der
Nachfrage der Amag-Mitarbeiter nach Nahrungsmitteln. Für 1913 errechnet sich für
93
Vgl. Gerhard Philipp Wolf und Walter Tausendpfund, Pegnitz – Veldensteiner Forst, 63 f, 66 ff.
94
1818 wurden die beiden Ortschaften eine Gemeinde, aber erst 1876 erhielten die Bewohner der
Altstadt die gleichen Rechte und Pflichten wie die Bewohner der „Stadt“. Vgl. Bauer II, 555, 558.
95
Zitiert bei Gerhard Philipp Wolf und Walter Tausendpfund, Pegnitz-Veldensteiner Forst, 393 ff.
96
Bis zur Ansiedlung der Pegnitzhütte, also bis 1890, gab es nur wenige Katholiken in Pegnitz. Vgl.
Abschnitt 4.3.1.2.
97
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, 831.
Walter Tausendpfund, Handel, Handwerk, Industrie im Verlauf der Pegnitzer Stadtgeschichte, in: Peg-
nitz – 650 Jahre Stadt, 113.