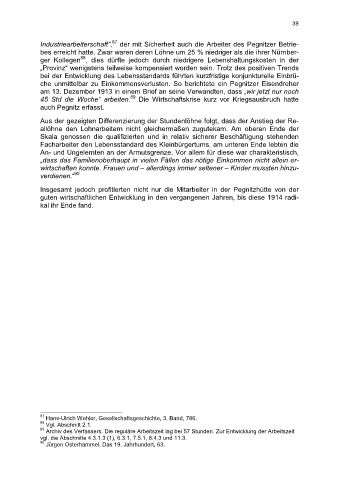Page 47 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 47
39
87
Industriearbeiterschaft“, der mit Sicherheit auch die Arbeiter des Pegnitzer Betrie-
bes erreicht hatte. Zwar waren deren Löhne um 25 % niedriger als die ihrer Nürnber-
88
ger Kollegen , dies dürfte jedoch durch niedrigere Lebenshaltungskosten in der
„Provinz“ wenigstens teilweise kompensiert worden sein. Trotz des positiven Trends
bei der Entwicklung des Lebensstandards führten kurzfristige konjunkturelle Einbrü-
che unmittelbar zu Einkommensverlusten. So berichtete ein Pegnitzer Eisendreher
am 13. Dezember 1913 in einem Brief an seine Verwandten, dass „wir jetzt nur noch
89
45 Std die Woche“ arbeiten. Die Wirtschaftskrise kurz vor Kriegsausbruch hatte
auch Pegnitz erfasst.
Aus der gezeigten Differenzierung der Stundenlöhne folgt, dass der Anstieg der Re-
allöhne den Lohnarbeitern nicht gleichermaßen zugutekam. Am oberen Ende der
Skala genossen die qualifizierten und in relativ sicherer Beschäftigung stehenden
Facharbeiter den Lebensstandard des Kleinbürgertums, am unteren Ende lebten die
An- und Ungelernten an der Armutsgrenze. Vor allem für diese war charakteristisch,
„dass das Familienoberhaupt in vielen Fällen das nötige Einkommen nicht allein er-
wirtschaften konnte. Frauen und – allerdings immer seltener – Kinder mussten hinzu-
90
verdienen.“
Insgesamt jedoch profitierten nicht nur die Mitarbeiter in der Pegnitzhütte von der
guten wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren, bis diese 1914 radi-
kal ihr Ende fand.
87
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, 786.
88
Vgl. Abschnitt 2.1.
89
Archiv des Verfassers. Die reguläre Arbeitszeit lag bei 57 Stunden. Zur Entwicklung der Arbeitszeit
vgl. die Abschnitte 4.3.1.3 (1), 6.3.1, 7.5.1, 8.4.3 und 11.3.
90
Jürgen Osterhammel, Das 19. Jahrhundert, 63.