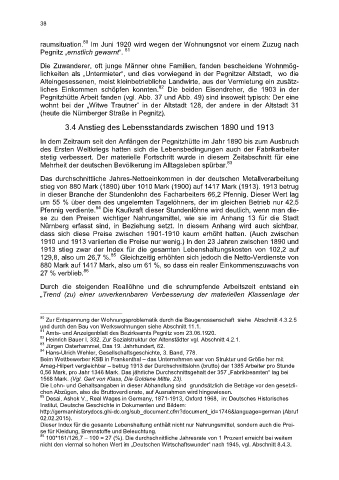Page 46 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 46
38
80
raumsituation. Im Juni 1920 wird wegen der Wohnungsnot vor einem Zuzug nach
81
Pegnitz „ernstlich gewarnt“.
Die Zuwanderer, oft junge Männer ohne Familien, fanden bescheidene Wohnmög-
lichkeiten als „Untermieter“, und dies vorwiegend in der Pegnitzer Altstadt, wo die
Alteingesessenen, meist kleinbetriebliche Landwirte, aus der Vermietung ein zusätz-
82
liches Einkommen schöpfen konnten. Die beiden Eisendreher, die 1903 in der
Pegnitzhütte Arbeit fanden (vgl. Abb. 37 und Abb. 49) sind insoweit typisch: Der eine
wohnt bei der „Witwe Trautner“ in der Altstadt 128, der andere in der Altstadt 31
(heute die Nürnberger Straße in Pegnitz).
3.4 Anstieg des Lebensstandards zwischen 1890 und 1913
In dem Zeitraum seit den Anfängen der Pegnitzhütte im Jahr 1890 bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs hatten sich die Lebensbedingungen auch der Fabrikarbeiter
stetig verbessert. Der materielle Fortschritt wurde in diesem Zeitabschnitt für eine
83
Mehrheit der deutschen Bevölkerung im Alltagsleben spürbar.
Das durchschnittliche Jahres-Nettoeinkommen in der deutschen Metallverarbeitung
stieg von 880 Mark (1890) über 1010 Mark (1900) auf 1417 Mark (1913). 1913 betrug
in dieser Branche der Stundenlohn des Facharbeiters 66,2 Pfennig. Dieser Wert lag
um 55 % über dem des ungelernten Tagelöhners, der im gleichen Betrieb nur 42,5
84
Pfennig verdiente. Die Kaufkraft dieser Stundenlöhne wird deutlich, wenn man die-
se zu den Preisen wichtiger Nahrungsmittel, wie sie im Anhang 13 für die Stadt
Nürnberg erfasst sind, in Beziehung setzt. In diesem Anhang wird auch sichtbar,
dass sich diese Preise zwischen 1901-1910 kaum erhöht hatten. (Auch zwischen
1910 und 1913 variierten die Preise nur wenig.) In den 23 Jahren zwischen 1890 und
1913 stieg zwar der Index für die gesamten Lebenshaltungskosten von 102,2 auf
85
129,8, also um 26,7 %. Gleichzeitig erhöhten sich jedoch die Netto-Verdienste von
880 Mark auf 1417 Mark, also um 61 %, so dass ein realer Einkommenszuwachs von
86
27 % verblieb.
Durch die steigenden Reallöhne und die schrumpfende Arbeitszeit entstand ein
„Trend (zu) einer unverkennbaren Verbesserung der materiellen Klassenlage der
80
Zur Entspannung der Wohnungsproblematik durch die Baugenossenschaft siehe Abschnitt 4.3.2.5
und durch den Bau von Werkswohnungen siehe Abschnitt 11.1.
81
Amts- und Anzeigenblatt des Bezirksamts Pegnitz vom 23.06.1920.
82
Heinrich Bauer I, 332. Zur Sozialstruktur der Altenstädter vgl. Abschnitt 4.2.1.
83
Jürgen Osterhammel, Das 19. Jahrhundert, 62.
84
Hans-Ulrich Wehler, Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, 778.
Beim Wettbewerber KSB in Frankenthal – das Unternehmen war von Struktur und Größe her mit
Amag-Hilpert vergleichbar – betrug 1913 der Durchschnittslohn (brutto) der 1385 Arbeiter pro Stunde
0,56 Mark, pro Jahr 1346 Mark. Das jährliche Durchschnittsgehalt der 357 „Fabrikbeamten“ lag bei
1568 Mark. (Vgl. Gert von Klass, Die Goldene Mitte, 23).
Die Lohn- und Gehaltsangaben in dieser Abhandlung sind grundsätzlich die Beträge vor den gesetzli-
chen Abzügen, also die Bruttoverdienste, auf Ausnahmen wird hingewiesen.
85
Desai, Ashok V., Real Wages in Germany, 1871-1913, Oxford 1968, in: Deutsches Historisches
Institut, Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern:
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1746&language=german (Abruf
02.02.2015).
Dieser Index für die gesamte Lebenshaltung enthält nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch die Prei-
se für Kleidung, Brennstoffe und Beleuchtung.
86
100*161/126,7 – 100 = 27 (%). Die durchschnittliche Jahresrate von 1 Prozent erreicht bei weitem
nicht den viermal so hohen Wert im „Deutschen Wirtschaftswunder“ nach 1945, vgl. Abschnitt 8.4.3.