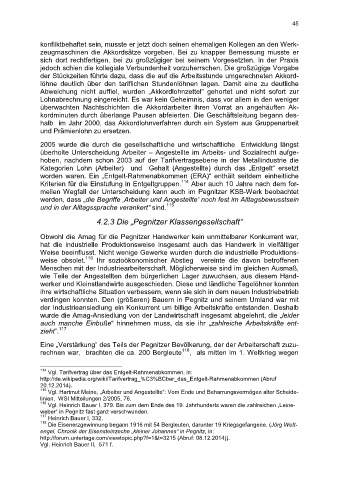Page 53 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 53
45
konfliktbehaftet sein, musste er jetzt doch seinen ehemaligen Kollegen an den Werk-
zeugmaschinen die Akkordsätze vorgeben. Bei zu knapper Bemessung musste er
sich dort rechtfertigen, bei zu großzügiger bei seinem Vorgesetzten. In der Praxis
jedoch schien die kollegiale Verbundenheit vorzuherrschen. Die großzügige Vorgabe
der Stückzeiten führte dazu, dass die auf die Arbeitsstunde umgerechneten Akkord-
löhne deutlich über den tariflichen Stundenlöhnen lagen. Damit eine zu deutliche
Abweichung nicht auffiel, wurden „Akkordlohnzettel“ gehortet und nicht sofort zur
Lohnabrechnung eingereicht. Es war kein Geheimnis, dass vor allem in den weniger
überwachten Nachtschichten die Akkordarbeiter ihren Vorrat an angehäuften Ak-
kordminuten durch überlange Pausen abfeierten. Die Geschäftsleitung begann des-
halb im Jahr 2000, das Akkordlohnverfahren durch ein System aus Gruppenarbeit
und Prämienlohn zu ersetzen.
2005 wurde die durch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung längst
überholte Unterscheidung Arbeiter – Angestellte im Arbeits- und Sozialrecht aufge-
hoben, nachdem schon 2003 auf der Tarifvertragsebene in der Metallindustrie die
Kategorien Lohn (Arbeiter) und Gehalt (Angestellte) durch das „Entgelt“ ersetzt
worden waren. Ein „Entgelt-Rahmenabkommen (ERA)“ enthält seitdem einheitliche
Kriterien für die Einstufung in Entgeltgruppen. 114 Aber auch 10 Jahre nach dem for-
mellen Wegfall der Unterscheidung kann auch im Pegnitzer KSB-Werk beobachtet
werden, dass „die Begriffe ‚Arbeiter und Angestellte‘ noch fest im Alltagsbewusstsein
und in der Alltagssprache verankert“ sind. 115
4.2.3 Die „Pegnitzer Klassengesellschaft“
Obwohl die Amag für die Pegnitzer Handwerker kein unmittelbarer Konkurrent war,
hat die industrielle Produktionsweise insgesamt auch das Handwerk in vielfältiger
Weise beeinflusst. Nicht wenige Gewerke wurden durch die industrielle Produktions-
weise obsolet. 116 Ihr sozioökonomischer Abstieg vereinte die davon betroffenen
Menschen mit der Industriearbeiterschaft. Möglicherweise sind im gleichen Ausmaß,
wie Teile der Angestellten dem bürgerlichen Lager zuwuchsen, aus diesem Hand-
werker und Kleinstlandwirte ausgeschieden. Diese und ländliche Tagelöhner konnten
ihre wirtschaftliche Situation verbessern, wenn sie sich in dem neuen Industriebetrieb
verdingen konnten. Den (größeren) Bauern in Pegnitz und seinem Umland war mit
der Industrieansiedlung ein Konkurrent um billige Arbeitskräfte entstanden. Deshalb
wurde die Amag-Ansiedlung von der Landwirtschaft insgesamt abgelehnt, die „leider
auch manche Einbuße“ hinnehmen muss, da sie ihr „zahlreiche Arbeitskräfte ent-
zieht“. 117
Eine „Verstärkung“ des Teils der Pegnitzer Bevölkerung, der der Arbeiterschaft zuzu-
rechnen war, brachten die ca. 200 Bergleute 118 , als mitten im 1. Weltkrieg wegen
114
Vgl. Tarifvertrag über das Entgelt-Rahmenabkommen, in:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tarifvertrag_%C3%BCber_das_Entgelt-Rahmenabkommen (Abruf
20.12.2014).
115
Vgl. Hartmut Meine, „Arbeiter und Angestellte“: Vom Ende und Beharrungsvermögen alter Scheide-
linien, WSI Mitteilungen 2/2005, 76.
116
Vgl. Heinrich Bauer I, 379. Bis zum dem Ende des 19. Jahrhunderts waren die zahlreichen „Leine-
weber“ in Pegnitz fast ganz verschwunden.
117
Heinrich Bauer I, 332.
118
Die Eisenerzgewinnung begann 1916 mit 54 Bergleuten, darunter 19 Kriegsgefangene. (Jörg Wett-
engel, Chronik der Eisensteinzeche „kleiner Johannes“ in Pegnitz, in:
http://forum.untertage.com/viewtopic.php?f=1&t=3215 (Abruf: 08.12.2014)).
Vgl. Heinrich Bauer II, 571 f.