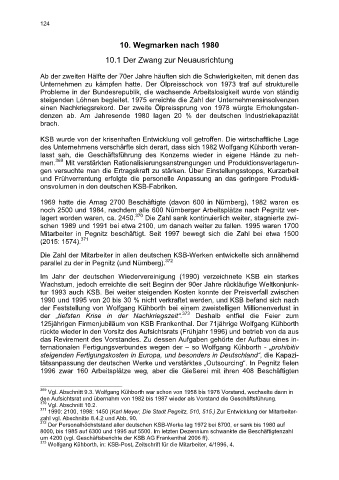Page 132 - Amag-KSB-Pegnitz 2020
P. 132
124
10. Wegmarken nach 1980
10.1 Der Zwang zur Neuausrichtung
Ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre häuften sich die Schwierigkeiten, mit denen das
Unternehmen zu kämpfen hatte. Der Ölpreisschock von 1973 traf auf strukturelle
Probleme in der Bundesrepublik, die wachsende Arbeitslosigkeit wurde von ständig
steigenden Löhnen begleitet. 1975 erreichte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen
einen Nachkriegsrekord. Der zweite Ölpreissprung von 1978 würgte Erholungsten-
denzen ab. Am Jahresende 1980 lagen 20 % der deutschen Industriekapazität
brach.
KSB wurde von der krisenhaften Entwicklung voll getroffen. Die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens verschärfte sich derart, dass sich 1982 Wolfgang Kühborth veran-
lasst sah, die Geschäftsführung des Konzerns wieder in eigene Hände zu neh-
men. 369 Mit verstärkten Rationalisierungsanstrengungen und Produktionsverlagerun-
gen versuchte man die Ertragskraft zu stärken. Über Einstellungsstopps, Kurzarbeit
und Frühverrentung erfolgte die personelle Anpassung an das geringere Produkti-
onsvolumen in den deutschen KSB-Fabriken.
1969 hatte die Amag 2700 Beschäftigte (davon 600 in Nürnberg), 1982 waren es
noch 2500 und 1984, nachdem alle 600 Nürnberger Arbeitsplätze nach Pegnitz ver-
lagert worden waren, ca. 2450. 370 Die Zahl sank kontinuierlich weiter, stagnierte zwi-
schen 1989 und 1991 bei etwa 2100, um danach weiter zu fallen. 1995 waren 1700
Mitarbeiter in Pegnitz beschäftigt. Seit 1997 bewegt sich die Zahl bei etwa 1500
(2015: 1574). 371
Die Zahl der Mitarbeiter in allen deutschen KSB-Werken entwickelte sich annähernd
parallel zu der in Pegnitz (und Nürnberg). 372
Im Jahr der deutschen Wiedervereinigung (1990) verzeichnete KSB ein starkes
Wachstum, jedoch erreichte die seit Beginn der 90er Jahre rückläufige Weltkonjunk-
tur 1993 auch KSB. Bei weiter steigenden Kosten konnte der Preisverfall zwischen
1990 und 1995 von 20 bis 30 % nicht verkraftet werden, und KSB befand sich nach
der Feststellung von Wolfgang Kühborth bei einem zweistelligen Millionenverlust in
der „tiefsten Krise in der Nachkriegszeit“. 373 Deshalb entfiel die Feier zum
125jährigen Firmenjubiläum von KSB Frankenthal. Der 71jährige Wolfgang Kühborth
rückte wieder in den Vorsitz des Aufsichtsrats (Frühjahr 1996) und betrieb von da aus
das Revirement des Vorstandes. Zu dessen Aufgaben gehörte der Aufbau eines in-
ternationalen Fertigungsverbundes wegen der – so Wolfgang Kühborth - „prohibitiv
steigenden Fertigungskosten in Europa, und besonders in Deutschland“, die Kapazi-
tätsanpassung der deutschen Werke und verstärktes „Outsourcing“. In Pegnitz fielen
1996 zwar 160 Arbeitsplätze weg, aber die Gießerei mit ihren 408 Beschäftigten
369
Vgl. Abschnitt 9.3. Wolfgang Kühborth war schon von 1958 bis 1978 Vorstand, wechselte dann in
den Aufsichtsrat und übernahm von 1982 bis 1987 wieder als Vorstand die Geschäftsführung.
370
Vgl. Abschnitt 10.2.
371
1990: 2100, 1998: 1450 (Karl Meyer, Die Stadt Pegnitz, 510, 515.) Zur Entwicklung der Mitarbeiter-
zahl vgl. Abschnitte 8.4.2 und Abb. 90.
372
Der Personalhöchststand aller deutschen KSB-Werke lag 1972 bei 8700, er sank bis 1980 auf
8000, bis 1985 auf 6300 und 1995 auf 5500. Im letzten Dezennium schwankte die Beschäftigtenzahl
um 4200 (vgl. Geschäftsberichte der KSB AG Frankenthal 2006 ff).
373
Wolfgang Kühborth, in: KSB-Post, Zeitschrift für die Mitarbeiter, 4/1996, 4.